Im ersten Teil habe ich den Rapper Haftbefehl vorgestellt – ein inneres Kriegskind mit Kokain in der Blutbahn und einer Vaterwunde im Herzen. Seine Geschichte ist laut, schmutzig, gefährlich.
Doch was passiert mit jenen, die nicht auf der Straße gekämpft haben, sondern in echtem Kriegsgebiet? Die nicht Raptexte schreiben, sondern mit echten Waffen im Einsatz waren?
Der zweite Teil meiner Reise durch Schmerz und Heilung beginnt mit der Netflix-Doku „In Waves and War“.
Das seelische Gefängnis
Im Zentrum: ehemalige US Navy SEALs – Männer wie Marcus Capone, Matty Roberts und DJ Shipley. Jeder von ihnen diente in Irak und Afghanistan. Nach außen Helden, nach innen Ruinen.
Zurück in der Heimat warteten keine Paraden auf sie, sondern Albträume, Flashbacks, Depressionen, Panikattacken. Und der ganz normale Wahnsinn im Kopf: posttraumatische Belastungsstörung, Hirnverletzungen, suizidale Gedanken.
Apropos: 7.100 US Soldaten starben im Krieg. Aber über 30.000 begingen nach dem Krieg Selbstmord.
Die Familien? Kollateralopfer. Amber Capone, die Ehefrau von Marcus, beschreibt es, als würde jemand geliebte Menschen in Zeitlupe verschwinden sehen – körperlich da, seelisch unerreichbar.
Medikamente, Therapien, Klinikaufenthalte: Alles versucht. Nichts griff.
Was macht ein Krieg mit der Seele? Und wie heilt man eine Wunde, für die es keine Sprache gibt?
Die Netflix-Doku „In Waves and War“ antwortet mit einer …
Reise ins Unsagbare.
Die Protagonisten der Doku nehmen Ibogaine und 5-MeO-DMT – psychedelische Substanzen, die in indigenen Kulturen seit Jahrhunderten als Tore zur Seele gelten.
Anfangs sind die Navy SEALs skeptisch – Psychedelika? Das ist doch was für Hippies. Doch die innere Hölle ist erbarmungslos. Und wenn klassische Therapie versagt, greift man nach dem letzten Strohhalm.
In der Doku berichten mehrere Soldaten von ihrer Reise in das dunkle Reich der eigenen Seele. Besonders bewegend war für mich die Geschichte von Kaden.
Anfangs wirkt der Trip fast angenehm, doch dann reißt ihn eine unsichtbare Kraft in die Tiefe. Um ihn herum wirbeln regenbogenschillernde Schubladen einer Kommode – jede ein Speicherplatz für verdrängte Erinnerungen. Kaden kann sie öffnen, hineinspringen, erfahren – und zurückkehren.
Plötzlich steht er mitten in seiner Kindheit. Er sieht sich selbst, wie sein Vater ausrastet – wegen eines defekten Rasenmähers.
Kaden: »Mein Vater war groß, so 115 Kilo, überall tätowiert. Er jagte mir eine Scheißangst ein. Ich dachte, er würde mich umbringen. Ich sah, wie er den Griff packte, ihn über den Kopf schwang und auf den Boden knallte. Das Ding zerbrach in Stücke. Ich konnte die Hitze in mir fühlen, die aus seiner Wut kam – wie verdammt wütend er auf mich war.
Und dann veränderte sich das Bild. Er schrie nicht mehr mich an – ich schrie (meine Frau) Lola an. Ich hatte genau dasselbe getan. Ich erinnere mich, wie ich ein Puppenhaus in tausend Stücke schlug.
Mein Gesicht spiegelte das von meinem Vater. Dann verschob sich das Bild wieder, und ich sah (meine Tochter) Patsy hereinkommen. Ich fühlte ihre Emotionen. Ich fühlte das Trauma, das sie durchmachte. Und ich fühlte das Trauma, das ich abbekommen hatte.«
Soweit ein kurzer Auszug, der etwas Wesentliches beleuchtet: Eine seelische Wunde kann von Generation zu Generation weitergegeben und damit »vererbt« werden. (Der Fachbegriff dazu: Transgenerationale Traumatisierung)
Mit anderen Worten:
Verletzte Menschen verletzen Menschen.
Und zwar solange, bis die Wunde geheilt wird.
Wie?
In animierten Bildern zeigt die Doku, was Worte nicht fassen können: Kindheitstraumata, Schuld, Schmerz – alles flackert auf. Und bricht auf. Die Veteranen sprechen von Lebensrückblicken, aber auch von Visionen, Erkenntnissen, die sie wieder mit sich selbst verbinden. Manche erleben zum ersten Mal so etwas wie Vergebung – oder inneren Frieden.
Sind sie danach vollends geheilt?
Nein.
Aber etwas wurde bei allen transformiert.
Ein Mann namens Elias Kfoury litt zwölf Jahre lang unter quälenden Kopfschmerzen. Erst bei seiner Ibogaine-Erfahrung geschah etwas Unerwartetes: Die Schmerzen verschwanden.
In den Aufzeichnungen der Wissenschaftler (Stanford University), die das Experiment begleitet hatten, steht nüchtern: *Keine Symptome schwerer PTBS mehr. Doch zwischen den Zeilen spürt man: Hier hat sich etwas bewegt, das keine Statistik beschreiben kann.
Ein weiterer Veteran, Joe, konstatiert: »Da ist ein Licht in meinen Augen, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen habe.«
Doch der Ex-Soldat Marcus Capone* (siehe Quellen) zieht in der Doku das Fazit, dass Ibogaine keine Wunderdroge sei. Es lösche nicht einfach alle Dunkelheit aus. Aber es öffne einen Raum, in dem Heilung beginnen kann.
Wunden brauchen Innere Autorität
Um eines klar zu stellen. Dieser Blogartikel ist kein Plädoyer für den Einsatz von Psychedelika in der Therapie. Das Pro & Contra sollen andere austragen.
Mir geht es vielmehr darum, was heilt.
Flucht ist keine Lösung. Haftbefehl und die Soldaten zeigen eindrücklich: Je weiter man flieht, desto näher kommt die Wunde.
Der Weg ins Erfolgsreich beginnt in dem Moment, in dem wir aufhören, gegen unsere Wunden zu kämpfen – und beginnen, ihnen zuzuhören.
Denn:
Die Wunde kennt die Wahrheit, die uns befreien kann.
Kadens Story zeigt: Erst als er versteht, was ihm angetan wurde und was er anderen angetan hatte, kann er sich befreien.
Vorher war er in einem Dickicht von Stimmungen, Ängsten und Zorn gefangen – und das bewusste Betrachten war wie eine Machete, mit der er sich daraus befreien konnte.
Aber Vorsicht: Niemand sollte diesen Weg allein gehen.
Es braucht Menschen, die Räume halten können – Begleiter, Therapeuten, Seelenzeugen. Ohne ihre Unterstützung hätten die Veteranen nicht durch die Dunkelheit gehen und heil wieder herauskommen können.
Aber die Essenz bleibt: Entscheidend ist, den Schmerz nicht länger zu meiden, sondern ihm ins Auge zu blicken.
Dafür braucht es eine Kraft, die ich »Innere Autorität« nenne – die Fähigkeit, dem Schmerz standzuhalten, ihn bewusst wahrzunehmen, ohne sich selbst darin zu verlieren. Nur dann kann man ihm zuhören. Und ihn danach schrittweise heilen.
»Wenn ich heute an einen dunklen Ort komme«, sagt einer der Soldaten, »bin ich nicht mehr darin gefangen. Ich sehe ihn. Ich erkenne, dass ich Beobachter bin – nicht mehr das Opfer. Die Dunkelheit hat ihre Macht verloren.“
Ein Satz wie ein Lichtstrahl: leise, aber durchdringend. Wie das Nachleuchten eines Traums, der nicht mehr von Flucht handelt – sondern von Ankommen.
Quellen
In Waves and War, Netflix
Interview mit Marcus Capote zum Film, PBS, (gesehen: 09.11.25)
Die Website zur Doku, (gesehen: 09.11.25)
The Gripping Story Behind Netflix’s In Waves and War, times.com (gesehen: 09.11.25)



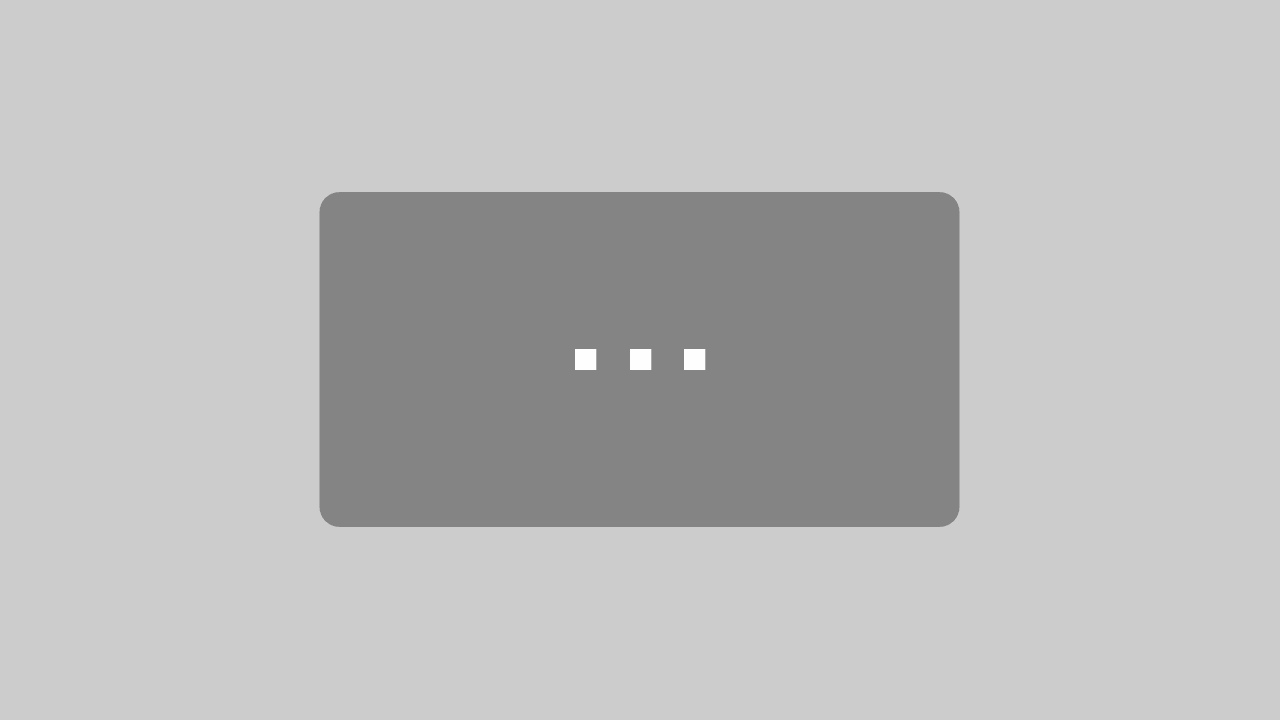

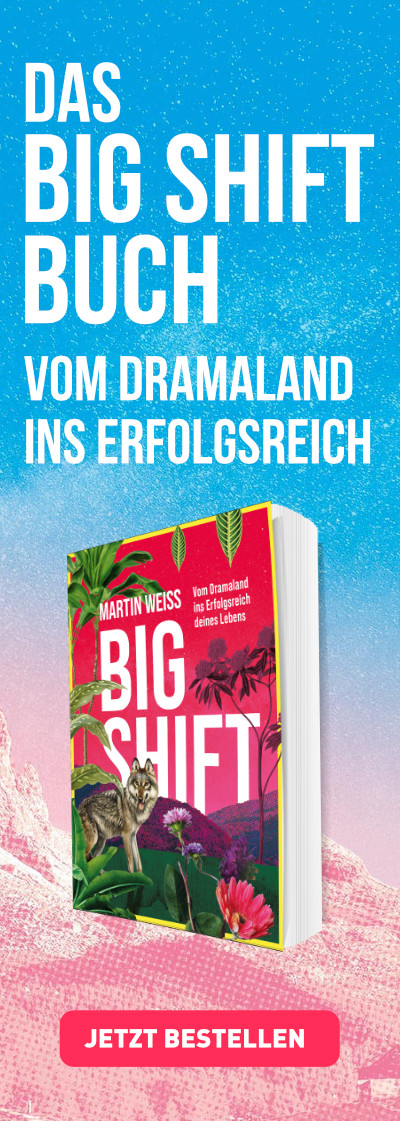



Neben solchen Erlebnissen kommen mir meine frühen und späteren Pubertätsdunkelheiten ganz lächerlich vor. Aber es tat sehr weh, so allein zu sein mit 15. Trotz liebevoller Eltern und anderen Verwandten. Aber sie haben mich wenigstens vor Drogen etc bewahrt. Dafür danke ich ihnen sehr.
Ich hab auch einen Code für die Quälgeister: BHKTGM
Viel Spass bei Knacken!
Danke Martin für den Text. Ich habe sehr Gänsehaut bekommen, weil er mich so berührt hat.